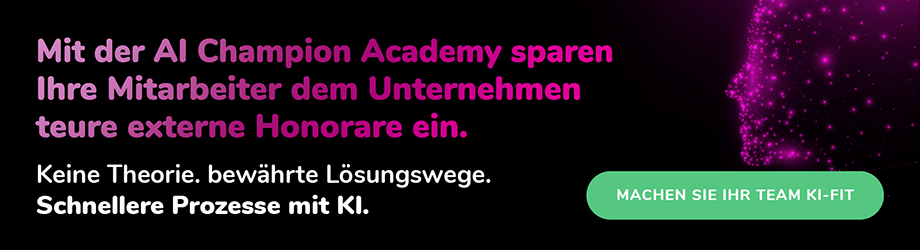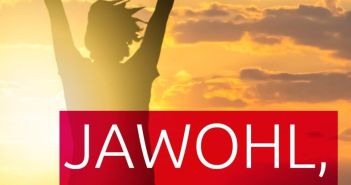Sinkt das allgemeine Preisniveau für Produkte und Leistungen über eine längere Zeit, entsteht eine Inflation. Das Geld verliert an Wert, Arbeitnehmer können sich weniger für ihren Lohn leisten. In der Folge tätigen sie weniger Neuanschaffungen, Unternehmen gehen Einnahmen verloren. Auch für sie bedeutet das eine enorme finanzielle Belastung, durch die sie dem Wunsch der Arbeitnehmer nach einer Lohnerhöhung häufig nicht nachkommen können. Die Kaufkraft sinkt weiter. Doch für Angestellte gibt es Wege aus der Abwärtsspirale.
Inflation: Was das bedeutet und wie sie gemessen wird
Der Begriff „Inflation“ geht auf die lateinische Bezeichnung für das Aufblähen zurück. Gemeint ist damit, dass sich das Preisniveau für Güter und Dienstleistungen „aufbläht“, also enorm erhöht. Löhne und Gehälter steigen jedoch deutlich langsamer oder gar nicht, damit sinkt die Kaufkraft. Für den gleichen Geldwert erhalten Arbeitnehmer nun weniger. Die Inflation bedeutet damit immer eine Kaufkraftminderung und hat große wirtschaftliche Auswirkungen.
PCE Zahlen und die Messung der Inflation
Auf der einen Seite sind es die PCE Zahlen, die zur Messung der Inflation herangezogen werden. Dabei handelt es sich um die „Personal Consumption Expenditures“, die auch als Konsumausgaben bezeichnet werden. Dieser Index bezieht sich auf die Konsumgewohnheiten der US-Amerikaner und misst die Ausgaben für Konsumgüter. Der PCE macht rund ein Drittel der Inlandsausgaben aus und gilt als Treiber für das Bruttoinlandsprodukt. Die Federal Reserve Bank (FED) nutzt den PCE, um die Inflation zu messen. Fällt nun diese PCE Kerninflation geringer als erwartet aus, kann die FED ihre Prognosen zur Inflation nach unten korrigieren und senkt eventuell die Zinsen. Umgekehrt kann ein höherer FED für eine Zinserhöhung sorgen. Diese Zinsentscheidungen wiederum wirken sich direkt auf die Aktien- und Wechselkurse sowie allgemein auf die Finanzmärkte aus.
Unternehmen könnten sich durch niedrigere Zinsen für mehr Investitionen entscheiden, da sie günstiger Kredite bekommen. Damit wiederum kann der Bedarf an Arbeitskräften ebenso wie das Lohnniveau steigen. Es besteht die Gefahr der Lohn-Preis-Spirale, bei der die Kaufkraft trotz höherer Löhne nicht zunimmt.
Hierzulande wird die Inflation mithilfe des Verbraucherpreisindex gemessen. Dazu wird seitens des Statistischen Bundesamts das Preisniveau eines angenommenen Warenkorbs ermittelt, der als repräsentativ für Deutschland angesehen wird. Enthalten sind Lebensmittel und Kleidung ebenso wie Kfz und Versicherungen oder Mieten. Eine Veränderung des Index bezeichnen Finanzexperten als Inflations- oder Teuerungsrate. Normal liegt diese Rate bei null bis zwei Prozent. Steigt der Verbraucherpreisindex stärker, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Inflation zunimmt. Die Kaufkraft sinkt.
Ursachen der Inflation
Der Herstellungsprozess für viele Güter wird teurer, wenn die Preise für Rohstoffe oder Lohn- und Lohnnebenkosten steigen. Finanzfachleute sprechen von einer Angebotsinflation. Unternehmen erhöhen nun die Preise für ihre Produkte, die Mehrkosten müssen seitens der Verbraucher getragen werden. Die Kaufkraft sinkt, teure Neuanschaffungen werden aufgeschoben. Auch importierte Inflationen können dabei relevant sein. Hierbei geht es um die Preissteigerung bei importierten Rohstoffen, die Auswirkungen auf viele Länder der Welt haben.
Um zu verstehen, wie die Inflation entsteht, ist jedoch nicht nur die Funktionsweise der Angebotsinflation relevant, sondern auch die der Nachfrageinflation. Sie bewirkt eine Preissteigerung, weil Verbraucher stark auf bestimmte Güter und Leistungen fokussiert sind. Die Nachfrage übersteigt das Angebot, Unternehmen können diese trotz Steigerung ihrer Produktion nicht befriedigen. Die Verbraucherpreise steigen, die Kaufkraft nimmt in der Folge ab.
Das können Arbeitnehmer jetzt tun
Noch bis zum Ende 2024 konnten Arbeitgeber ihren Angestellten entgegenkommen und ihnen einen Inflationsausgleich von bis zu 3.000 Euro zahlen. Das können sie zwar jetzt in 2025 immer noch, doch nun ist dieser Ausgleich nicht mehr steuerfrei. Doch auch zuvor gab es keinen Zuschuss zur Inflationsprämie seitens des Staates, sie war eine gänzlich freiwillige Leistung.
Arbeitnehmer und die Inflation
Die Rechtslage ist klar: Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Gehaltserhöhung wegen der Inflation. Das Problem ist, dass die gestiegenen Preise auch für die Unternehmen selbst ein Problem sind. Selbst wenn der Arbeitgeber gern höhere Löhne und Gehälter zahlen möchte, sind ihm teilweise die Hände gebunden. Während einzelne Branchen satte Gewinne erzielen – allen voran die Rüstungsindustrie -, müssen andere auf hohe Umsätze oder gar Gewinne verzichten. Für diese Unternehmen ist es schlichtweg unmöglich, neben den eigenen hohen Ausgaben auch noch höhere Arbeitsentgelte zu zahlen. Zudem könnte die Inflation weiter angeheizt werden, denn wenn alle Mitarbeiter mehr Lohn bekommen, würde das die Preise für Produkte und Leistungen erhöhen – schließlich müssen die gestiegenen Kosten ausgeglichen werden.
Löhne und Inflation
Die bereits erwähnte Inflationsprämie ist eine Möglichkeit, um Arbeitnehmer zu unterstützen. Eine andere besteht in eigenständigen Maßnahmen, die nicht nur zur Erhöhung der Kaufkraft für den einzelnen Mitarbeiter sinnvoll, sondern die auch als Strategie zur Mitarbeiterbindung zu sehen sind. Zu nennen sind dabei unter anderem:
-
Anpassung an die Inflationsrate: Arbeitgeber können die Löhne und Gehälter an die Inflationsrate anpassen, was als Indexierung bezeichnet wird. Grundlage dafür ist der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts.
-
Flexiblere Arbeitszeiten: Damit hat der Mitarbeiter am Ende des Monats zwar nicht mehr Geld auf der Hand, jedoch weniger für sein Geld gearbeitet. Dies kommt einer Lohnerhöhung gleich.
-
Betriebliche Altersvorsorge: Diese ist schon lange eine Möglichkeit zur Mitarbeitergewinnung und -bindung. Wird sie mit inflationsgeschützten Anlagen verbunden, bedeutet sie einen echten Mehrwert für die Angestellten.
-
Weiterbildungsbudgets: Unternehmen können ihren Angestellten Weiterbildungen finanzieren, mit denen sie für qualifiziertere Positionen gerüstet sind. Mit diesen wiederum ist in der Regel ein höheres Gehalt verbunden, was als Anreiz zur Teilnahme an der Fortbildung eingesetzt werden kann.
-
Mobilitätszuschüsse: Ob mit der Bahn oder mit dem Auto: Mobilität ist teuer und kann vom Arbeitgeber unterstützt werden. Dabei kann sich dieser auf bestimmte Fortbewegungsmittel konzentrieren und fördert beispielsweise die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder finanziert ein Dienstfahrrad. Auch ein Tankgutschein ist denkbar, wenn der ökologische Aspekt unberücksichtigt bleiben soll oder muss.
Die sogenannten Sachbezüge sind ein nicht zu unterschätzender Kostenzuschuss, denn sie senken die Ausgaben für die Mitarbeiter spürbar und verlässlich. Anders als bei einer einmaligen Prämienzahlung können sich die Angestellten auf einen monatlichen Zuschuss verlassen und diesen entsprechend einplanen.
Zudem sind Zuschüsse zur Gesundheitsvorsorge für alle Beteiligten positiv und eine gute Alternative zu einer konkreten Lohnerhöhung. Zum einen helfen sie dabei, dass die Mitarbeiter weniger krank sind, sie sind damit produktiver und verursachen weniger Kosten. Zum anderen nutzen viele Angestellte derartig finanzierte Programme eher, als wenn sie selbst für die Kosten beispielsweise für ein Fitnessstudio aufkommen müssten. Die eigene Zufriedenheit und Motivation steigen.
Tipps für Arbeitnehmer
Viele Arbeitnehmer versuchen ihr Glück in Gehaltsverhandlungen und bringen die Inflation als Argument dafür, dass sie dringend mehr Geld benötigen, vor. Doch auch wenn dieses Argument nachvollziehbar sein mag, sollte es doch nicht allein maßgeblich sein, denn auch Unternehmen sind von den Teuerungen betroffen. Sie müssen ebenfalls hohe Ausgaben stemmen und sollen dann auch noch ihren Angestellten mehr Geld zahlen? Hier müssen bessere Argumente her! Es muss darum gehen, die eigenen Leistungen in den Vordergrund zu stellen:
- Projekte wurden erfolgreich zum Abschluss gebracht.
- Vorgaben und Ziele wurden erreicht.
- Neue Aufgaben und mehr Verantwortung wurden übernommen.
- Starkes Engagement für das Unternehmen wurde gezeigt.
- Ein neuer Posten wird angestrebt.
Angestellte sollten bei Gehaltsverhandlungen offen für Kompromisse sein und bedenken, dass weder die jährliche Gehaltserhöhung noch die Zahlung einer Inflationsprämie verpflichtend für Unternehmen sind. Die oben erwähnten Alternativen können jedoch in vielen Fällen als Zugeständnis für beide Seiten sinnvoll sein.